Staatsschulden = problematisch?
Die deutsche Schuldenbremse schreibt vor, dass grundsätzlich keine neuen Schulden aufgenommen werden dürfen, die über 0,35 % des nominalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) hinausgehen. Dabei basiert diese Zahl weder auf einer ökonomischen Theorie oder empirischen Studie, noch gibt es Beweise dafür, dass die Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen eines Staates ein bestimmtes Verhältnis zum BIP haben sollten. Die feste Verknüpfung des Umfangs von Staatsausgaben an das BIP bedingt zudem, dass erhöhten öffentlichen Ausgaben prinzipiell erst Wirtschaftswachstum vorausgehen muss. Staatsausgaben werden der Logik privatwirtschaftlicher Investitionen unterworfen – der Unterschied zwischen einem Währungsherausgeber und privatwirtschaftlich agierenden Akteuren wird verkannt.
Die Goldene Regel hingegen erlaubt das grundsätzliche Finanzieren staatlicher Investitionen über Kredite. Als Investitionen gilt dabei, was zukünftig zu mehr Wachstum führt oder zukünftig Kosten für die Allgemeinheit vermeidet. Das lockert zwar die Zügel, doch unterliegt derselben Wachstumslogik. Die Idee: Dadurch, dass Kreditaufnahme für Investitionen erlaubt wird, wird das Wachstum gesteigert, und damit auch künftige Steuereinnahmen. Der Wachstumseffekt der Investitionen soll zu Einnahmen führen, die höher sind, als die Kreditaufnahme in der Gegenwart.

Beide Varianten, sowohl die Schuldenbremse als auch die goldene Regel, unterliegen einem fundamentalen Denkfehler: Staatsschulden müssen sich finanziell auszahlen – also profitabel sein. Das Problem: Diese Herangehensweise funktioniert nur in einer endlos wachsenden globalen Wirtschaft und stützt somit den Wachstumszwang. Dass endloses Wirtschaftwachstum nicht dauerhaft mit unserem Klima vereinbar ist, sollte sich mittlerweile rumgesprochen haben. Und wer sich etwas mit progressiven ökonomischen Theorien auseinandergesetzt hat, weiß, dass weder die Schuldenbremse noch die goldene Regel etwas mit dem eigentlichen Wesen von Staatsausgaben zu tun haben.
Wie geht es richtig?
Halten wir ein paar Grundsätze fest: Geld ist keine knappe Ressource, um die sich Staaten streiten, sondern ein von einem Staat oder mehreren Staaten institutionalisiertes Zahlungsmittel. Ein souveräner Staat besitzt das Währungsmonopol und ist nicht auf Steuerannahmen angewiesen, um Staatsausgaben tätigen zu können. Er selbst gibt die Währung (über Umwege) über die Zentralbank in den Umlauf und sammelt es über Steuern wieder ein.
Staatsschulden in Eigenwährung eines souveränen Staates besagen also erst einmal nur, wie viel Geld ein Staat aktuell in den Umlauf gebracht hat und unterliegen nicht natürlicherweise einer Rückzahlungsforderung. Diese tritt erst durch selbst konstruierte Regeln für Kreditaufnahme bei der eigenen Zentralbank oder Machtgefälle zwischen verschiedenen souveränen und nicht souveränen Staaten (Staaten ohne eigene Währung und/oder ausreichend innenpolitische Kontrolle) auf.

Das heißt, anders als privatwirtschaftliche Ausgaben unterliegen Staatsausgaben keiner zwingenden Profitlogik, da hinter einem souveränen Staat kein weiterer Akteur steht, welcher das Geld (plus Zinsen) zurückfordert. Dass Deutschland heute die eigene Währung über Privatbanken (Bietergruppe) bei der eigenen europäischen Zentralbank „leihen“ und mit Zinsen zurückzahlen muss, ist kein Naturgesetz, sondern eine Regel, welche von Staaten geschaffen wurde und auch von Staaten wieder abgeschafft werden kann.
Daraus folgt, dass Staatsausgaben natürlicherweise nicht von Wirtschaftswachstum abhängig gemacht werden müssen, sondern von der Auslastung der Wirtschaft und den realen Ressourcen. Ausgaben eines souveränen Staates sind durch die verfügbaren Ressourcen, z.B. Arbeitskraft oder Rohstoffe begrenzt. Sie sind unproblematisch, solange sie die Kapazitäten einer Volkswirtschaft nicht überschreiten und somit keine erhöhte Nachfrage bei begrenztem Angebot und damit eine Inflation verursachen.
Dieser Realität werden sowohl die Schuldenbremse als auch die Goldene Regel nicht gerecht und sind somit mit einer Postwachstumsökonomie nicht vereinbar, da sie Profitlogik und Wachstumszwang weiterhin zementieren.
Wie sieht eine Postwachstums-geeignete Finanzpolitik aus?
Sowohl eine Reform der Schuldenbremse als auch ein Wechsel zur Goldenen Regel ist unter diesen Betrachtungspunkten nicht ausreichend. Öffentliche Ausgaben haben sich nicht an starre Grenzen zu richten und sind nicht fest an Wirtschaftswachstum oder Profiterwartungen zu knüpfen. Stattdessen müssen sich Notwendigkeit und Umfang öffentlicher Ausgaben an realen Kennzahlen der Volkswirtschaft orientieren.
In Deutschland könnten dafür unter Anderem die wissenschaftlichen Gutachten des unabhängigen Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (Wirtschaftsweisen) und Inflationsanalysen des Bundesfinanzministeriums und der Bundesbank herangezogen werden. Die Bundesregierung müsste Staatsausgaben im Sinne des Willens der Wähler an die aus den Berichten hervorgehenden wirtschaftlichen Kennzahlen ausrichten und transparent begründen. Institutionen wie der Bundesrechnungshof sowie Mechanismen wie Justiz, Presse und Wahlen können dabei als Kontrollmechanismen dienen, um missbräuchliches Regierungshandeln zu verhindern.

Eine Volkswirtschaft verträgt so viele staatliche Ausgaben, wie sie freie Ressourcen/Kapazitäten hat. Eine Vorgehensweise, welche Staatsausgaben von realen Kennzahlen der Volkswirtschaft, wie Branchenauslastung, Investitionsbedarf in Infrastruktur und Arbeitslosigkeit abhängig macht, frei von unwissenschaftlichen starren Grenzen und Gewinnerwartungen, könnte die Profitlogik und den Wachstumszwang durchbrechen. Staatsschulden müssen nicht durch Wirtschaftswachstum gerechtfertigt und durch Profite in der Zukunft zurückgezahlt werden. Sie dürfen nur keine Inflation auslösen.
Fazit: Ein Staat ist kein Unternehmen; er hat nichts von monetären „Profiten“ – außer die Regeln zwingen ihn dazu. Hinterfragen wir die Regeln, so ist der Weg zur Postwachstumsökonomie geebnet.
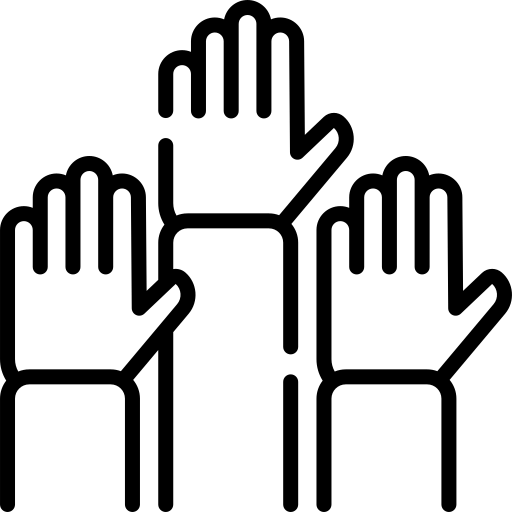

Schreibe einen Kommentar